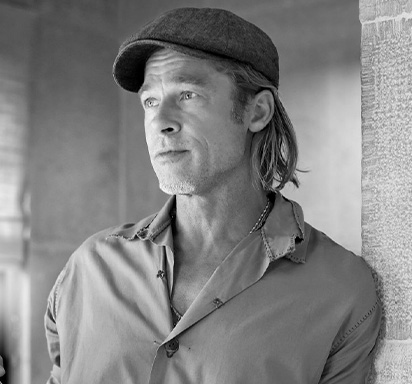Das Wein-Magazin
In Kürze startet die diesjährige Bordeaux Subskription. Was weiß man bislang über den Jahrgang 2023? Hier im Vorab eine Analyse der bevorstehenden Kampagne, frisch von unserem Team aus Bordeaux!
18.4.2024Aktuelles
Die Weinbranche bewegt sich permanent. Lesen Sie alles zu den Aktualitäten der Weingüter oder über die Erscheinungen von neuen Cuvées, Weinen, Champagnern und Spirituosen und lassen Sie sich über Weintourismus-Events informieren.
Zwischen raffinierter Architektur, außergewöhnlichen Tropfen und einem immersiven Shopping-Erlebnis: Entdecken Sie unseren neuen Weinshop im Herzen von New York in der 1257 2nd Avenue!
29.3.2024Spätestens seit der renommierte Wine Spectator den inzwischen legendären 2012er Miraval Rosé als „outstanding" bezeichnete und zum „weltweit besten Rosé“ erklärte, hat der Roséwein Kult-Status.
12.2.2024Von der hoch exklusiven Rotwein-Ikone über das raffinierte Weinaccessoire bis zur Süßwein-Rarität: Diese 8 Geschenkideen rund ums Thema Bordeaux lassen das Herz von Weinliebhabern und Connaisseuren höherschlagen – wetten?
23.11.2023Food-Pairing
Der richtige Wein hat das Zeug dazu, ein gutes Essen noch besser machen! Wir verraten Ihnen die wichtigsten Grundregeln - und unsere besten Weinpairings zu den beliebtesten Rezepten!
Im Schlaraffenland Frankreich gilt die Champagner-Erdbeer-Kombi als Inbegriff von Harmonie und Finesse. Doch welcher Luxus-Schäumer passt wirklich zu der verführerischen roten Sommerfrucht?
12.4.2024Kaum ein anderes Gemüse ist so emotional besetzt wie Spargel: Bei so manchen Gourmets löst das „weiße Gold“ regelrechte Frühlingsgefühle aus – und bei Weinfreunden mitunter Kopfzerbrechen …
5.4.2024Alles über Wein
Entdecken Sie die Arbeit der Winzer, erfahren Sie alles über die Rebsorten, perfekte Rotwein-Karaffen und die Herkunftsbezeichnungen und Regionen. Denn der Genuss dieses jahrtausendealten Getränks setzt Fachwissen voraus.
In Kürze startet die diesjährige Bordeaux Subskription. Was weiß man bislang über den Jahrgang 2023? Hier im Vorab eine Analyse der bevorstehenden Kampagne, frisch von unserem Team aus Bordeaux!
18.4.2024„Die Weinlese ist für mich immer ein Moment der intensiven Wahrheit", so Aubert de Villaine, Mitinhaber der Domaine de la Romanée-Conti. Erfahren Sie alles Wissenswerte zu dieser jahrhundertealten Tradition!
5.4.2024Vom Geschmacksprofil über attraktive kulinarische Kombinationen bis hin zur perfekten Trinktemperatur: Dieser Beitrag widmet sich dem berühmten Rotwein aus Venetien – und ist als eine Einladung zum Genießen zu verstehen.
27.3.2024Alles über Champagner
„Champagner ist wohl die glückhafteste Inspirationsquelle." Mark Twain. Es gibt wohl kein anderes Getränk, dessen alleinige Aussprache größere Emotionen erzeugt als Champagner. Unser Leitfaden rund um den edlen Luxus-Schaumwein.
Von der 6-Liter-Sonderabfüllung über die beliebtesten Limited Editions bis zum ultimativen Geschenkset: Wir haben die begehrtesten Dom Pérignon Champagner-Flaschen und Formate unter die Lupe genommen.
25.8.2023Von der Weinlese über die Méthode Champenoise bis zur Dosage: Die Herstellung des edlen Schaumweins ist ein hochkomplizierter, streng reglementierter Prozess. Wir erklären Ihnen die wichtigsten Etappen in sieben Schritten!
2.8.2023